Ein Beitrag inspiriert vom Kapitel „Heranwachsende in der zunehmen mediatisierten Gesellschaft: Kinder und Jugendliche im Spannungsfeld digitaler Medien“ von Daniel Hajok in „Medienerziehung in der digitalen Welt“ (Hrsg. Fleischer/Hajok)
Kinder und Jugendliche wachsen heute in einer Welt auf, die ohne digitale Medien kaum noch vorstellbar ist. Schon früh erschließen sie sich die Möglichkeiten von Smartphone, Internet und Social Media – und tun dies zunehmend eigenständig, ohne die ständige Begleitung Erwachsener. Für Eltern, Lehrkräfte und pädagogische Begleiter:innen stellt sich die Frage: Wie können wir Heranwachsende in dieser komplexen, mediatisierten Welt gut unterstützen?
Kinder auf neuen Wegen: Selbstständige Mediennutzung ab dem Grundschulalter
Früher gaben Eltern noch vor, welche Sendungen im Fernsehen liefen oder welche Bücher gelesen wurden. Heute dagegen wählen Kinder und Jugendliche selbstständig ihre Apps, YouTube-Kanäle oder TikTok-Stars aus – je nach Interessen und oft ohne Begleitung. Sie sind kleine Medienexpert:innen ihrer eigenen digitalen Welt. Das bedeutet einerseits: Sie entwickeln früh eine beeindruckende Medienkompetenz. Andererseits: Sie stoßen auf Inhalte, die für ihr Alter noch zu komplex oder belastend sein können.
Die Beschleunigung des Alltags: Digitaler Stress als neue Herausforderung
Parallel zur zunehmenden Selbstständigkeit erleben Heranwachsende auch, wie sehr sich das Lebenstempo beschleunigt hat. Ein kurzer Blick aufs Handy nach zwei Stunden Offline-Zeit genügt: Dutzende Nachrichten, verpasste Snaps, neue Posts und Videos warten. Für viele Jugendliche bedeutet diese Dauerpräsenz digitalen Stress. Wer nicht ständig antwortet oder liked, riskiert, in Freundesgruppen „unsichtbar“ zu werden. Die ständige digitale Erreichbarkeit raubt ihnen wichtige Momente des Innehaltens – und macht es schwer, bewusste Entscheidungen statt impulsiver Reaktionen zu treffen.
Während frühere Generationen noch die Aufforderung „Erst denken, dann handeln“ verinnerlichen konnten, bleibt dafür heute oft kaum noch Zeit. Entscheidungen werden schneller getroffen, Informationen schneller verarbeitet – manchmal auf Kosten der Achtsamkeit und inneren Ruhe.
Zwischen Schonraum und Experimentierraum: Neue Risiken und Herausforderungen
Mit dem eigenen Smartphone betreten Kinder spätestens ab dem zehnten oder elften Lebensjahr eine Welt, die ihnen zwar viele Türen öffnet – aber auch Fallstricke bereithält:
- Sie können sich kreativ ausdrücken: z.B. durch eigene Videos, Kunstwerke oder Blogs.
- Sie können sich vernetzen: mit Gleichgesinnten rund um die Welt, mit denen sie offline nie in Kontakt gekommen wären.
- Sie haben Zugang zu Wissen: von Tutorials über Naturwissenschaften bis hin zu politischer Bildung.
Gleichzeitig begegnen sie aber auch:
- Problematischen Inhalten: Gewalt, Pornografie, extremistische Botschaften können ihnen ungeschützt begegnen.
- Sozialem Druck: etwa durch Schönheitsideale, Challenges oder Gruppenzwang auf Plattformen wie TikTok oder Instagram.
- Datenfallen: Viele Apps sammeln persönliche Informationen oder verbergen Kosten hinter harmlos wirkenden Angeboten.
- Risiken wie Mobbing oder Sexting: Jugendliche sind nicht nur Opfer, sondern manchmal auch selbst Akteure solcher Dynamiken.
Diese doppelte Realität – voller Chancen und voller Risiken – verlangt nach einer Erziehung, die begleitet statt verbietet.
Medienerziehung heute: Vertrauen, Gespräche und echte Begleitung
Technische Schutzmaßnahmen wie Filtersysteme oder Bildschirmzeitbeschränkungen sind nützlich, reichen aber allein nicht aus.
Wer den Stecker zieht, riskiert, dass Kinder sich anderswo – bei Freunden, in offenen WLAN-Netzen – unbeaufsichtigt ins Netz begeben.
Wichtiger ist heute eine diskursiv-begleitende Medienerziehung, die Kinder frühzeitig stärkt:
- Offene Gespräche führen: Was läuft gut? Was war verstörend? Wo gibt es Fragen?
- Vertrauen aufbauen: Damit Kinder sich trauen, bei Problemen zu den Erwachsenen zu kommen.
- Selbstregulation fördern: Statt starrer Regeln gemeinsam lernen, Mediennutzung bewusst zu gestalten.
- Vorleben: Erwachsene sollten selbst reflektieren, wie sie mit ihrem Smartphone umgehen.
Denn: Medienkompetenz ist keine angeborene Fähigkeit – sie wird Schritt für Schritt erlernt.
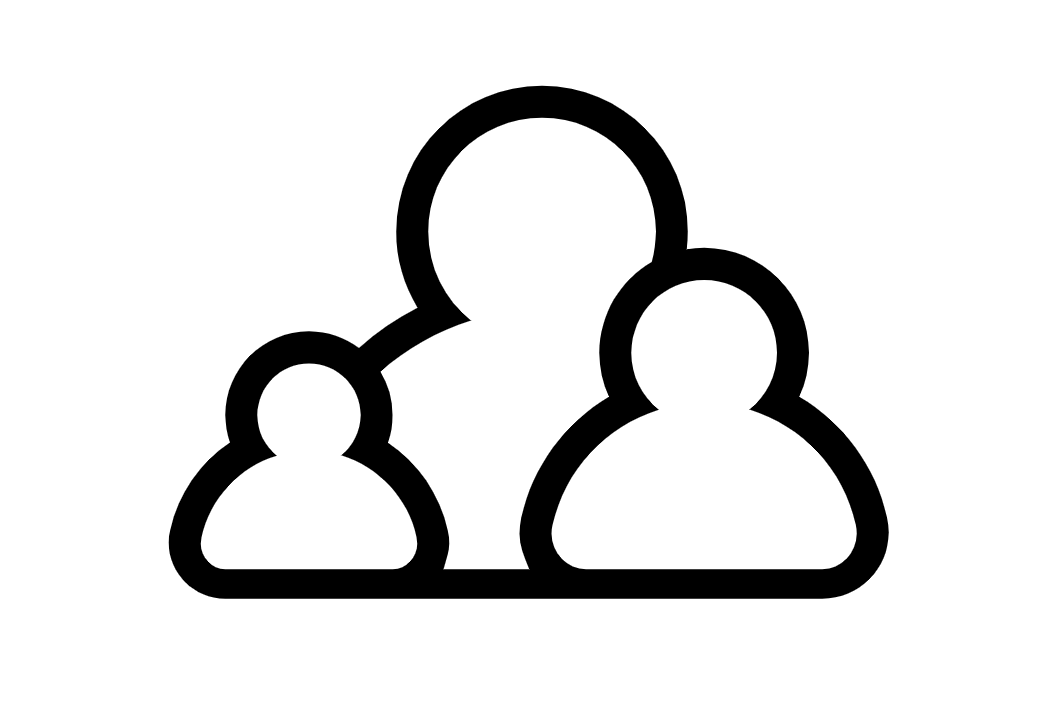

Schreibe einen Kommentar