Ein Beitrag inspiriert vom Kapitel „Erziehung ist politisch – eine Skizze“ von Ronald Lutz in „Medienerziehung in der digitalen Welt“ (Hrsg. Fleischer/Hajok)
Wenn wir über Medienerziehung sprechen, geht es oft um Apps, Bildschirmzeit oder Datenschutz. Doch selten wird ausgesprochen, was Medienerziehung in ihrem Kern wirklich ist: eine politische Praxis.
Der Sozialpädagoge Ronald Lutz betont in seinem Beitrag, dass Bildung nie neutral ist. Sie ist immer eingebettet in gesellschaftliche Verhältnisse – und diese sind nicht frei von Macht, Ausgrenzung und Ungleichheit. Medienpädagogik kann sich davor nicht drücken. Im Gegenteil: Sie muss sich dazu verhalten.
Erziehung als Befreiung – Die Pädagogik von Paulo Freire
Lutz greift zentrale Gedanken des brasilianischen Pädagogen Paulo Freire auf. Für Freire war Erziehung nie ein neutrales Vermitteln von Wissen, sondern ein Akt der Befreiung. Seine Pädagogik richtete sich gegen die „Kultur des Schweigens“, in der benachteiligte Gruppen keine Stimme haben.
Statt einseitiger Belehrung setzte Freire auf Dialog, Mitgestaltung und politische Bildung. Erziehung sollte nicht nur auf das Leben vorbereiten – sondern Beitrag zur Verbesserung der Welt sein. Sie wird zur Hoffnung und zur Utopie eines guten Lebens.
Pädagogik in der Migrationsgesellschaft – gegen verborgenen Kolonialismus
Ronald Lutz verweist auf die Herausforderungen der modernen Migrationsgesellschaft. Pädagogik darf nicht länger aus einer vermeintlich universellen, „weißen“ Mehrheitskultur heraus agieren, die anderen Lebenswelten übergeht oder gar unsichtbar macht.
Das, was Freire als „verborgenen Kolonialismus“ beschreibt, wirkt bis heute nach: durch fehlende Repräsentation, mangelnde Anerkennung und einseitige Deutungsmuster. Eine echte, verstehende Pädagogik muss diese kolonialen Strukturen hinterfragen, sich dem Anderen öffnen und den Alltag der Menschen in der Praxis spiegeln.
Digitale Medien: Ort der Befreiung – oder der Abhängigkeit?
Kinder und Jugendliche wachsen heute in einer zunehmend mediatisierten Welt auf. Digitale Medien bieten enorme Chancen zur Selbstsozialisation, Mitbestimmung und Ausdruckskraft. Aber sie bergen auch Risiken: Manipulation, Überwachung, Konsumdruck, Vereinzelung.
Medienerziehung als politische Bildungsaufgabe
Eine verstehende Pädagogik, wie Lutz sie fordert, geht radikal von den Kindern und Jugendlichen selbst aus. Sie orientiert sich an ihren Perspektiven, Fragen, Fähigkeiten – und traut ihnen Gestaltungsmacht zu.
Sie erkennt Kinder und Jugendliche als unvollendet, aber entwicklungsfähig, als kulturschöpferisch und dialogfähig. Und sie setzt auf Mitbestimmung statt Erziehung von oben.
Das ist ein klarer Widerspruch zur Tendenz, Politik aus der Pädagogik zu verbannen. Doch pädagogisches Handeln ist immer politisch – es beeinflusst, wen wir hören, wen wir stärken und wie wir unsere gemeinsame Zukunft gestalten.
Was bedeutet das für die Medienerziehung?
Eine politische Medienpädagogik…
- … ermöglicht Teilhabe – nicht nur durch Technik, sondern durch Haltung.
- … ermutigt Heranwachsende, ihre Stimme zu entdecken und ihre Welt mitzugestalten.
- … erkennt Medien nicht als Gefahr, sondern als Ort der Auseinandersetzung mit Gesellschaft.
- … macht sichtbar, was sonst unsichtbar bleibt – auch Machtverhältnisse, Diskriminierung, Ausgrenzung.
- … arbeitet an einer Utopie, in der Kinder und Jugendliche sich nicht „einfügen“, sondern ihre Welt selbst bauen können.
Meinungsfreiheit, Grundrechte und digitale Demokratie
Eine demokratische Gesellschaft lebt von der Möglichkeit zur Meinungsäußerung – ein Recht, das in Artikel 5 des Grundgesetzes garantiert ist. Doch gerade in digitalen Räumen zeigt sich, dass Meinungsfreiheit kein abstraktes Prinzip, sondern ein rechtlich geschütztes Gut mit konkreten Herausforderungen ist.
Hassrede, Desinformation und digitale Polarisierung bedrohen nicht nur den respektvollen Dialog, sondern stellen auch die Grundwerte der Demokratie infrage. Medienpädagogik, die an Freires Konzept der Befreiung anknüpft, darf diese Entwicklungen nicht ignorieren. Sie muss Heranwachsende befähigen, ihre Rechte zu kennen, kritisch zu nutzen und auch zu verteidigen – gegen Ausgrenzung, gegen Manipulation und gegen die Entwertung demokratischer Debattenkultur.
Gerade in mediatisierten Gesellschaften ist es Aufgabe pädagogischer Praxis, junge Menschen zur aktiven, verantwortungsvollen und rechtlich informierten Teilhabe zu befähigen – online wie offline.
Medienkompetenz ist Demokratiebildung
Medienpädagogik darf nicht auf Technikwissen reduziert werden. Sie muss als ganzheitliche Bildungsaufgabe verstanden werden: rechtlich fundiert, gesellschaftlich reflektiert und dialogisch gedacht.
Ziel ist es, Heranwachsende zu befähigen, Medien selbstbewusst, kritisch und kreativ zu nutzen – nicht nur als Konsument:innen, sondern als aktive Gestalter:innen ihrer digitalen Lebenswelt.
Demokratische Teilhabe beginnt genau hier. Medienerziehung übernimmt dabei eine zentrale politische Verantwortung: Sie eröffnet Räume für Mitbestimmung, schafft Bewusstsein für Machtverhältnisse und stärkt junge Menschen darin, sich ihre Welt anzueignen und selbst zu gestalten.
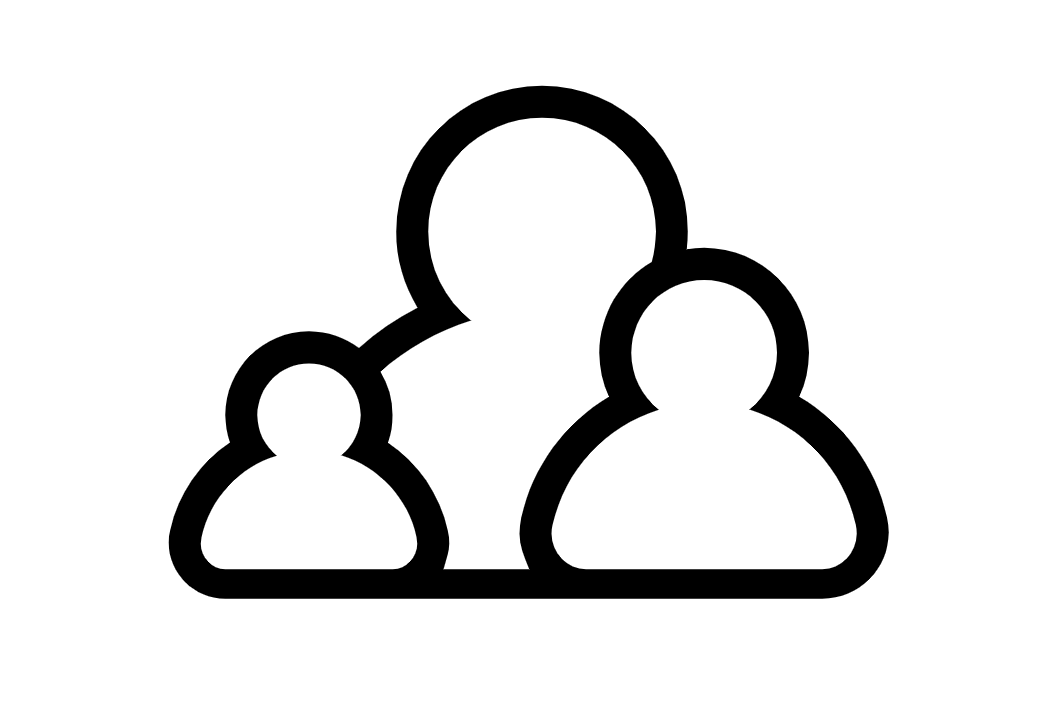

Schreibe einen Kommentar